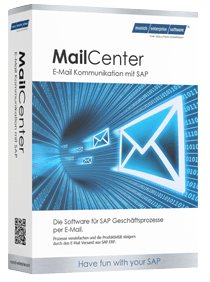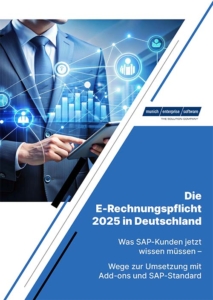E-Rechnungspflicht ab 2025 – das betrifft alle inländischen Unternehmen im B2B-Bereich. Ab dem 01.01.2025 müssen Firmen E-Rechnungen empfangen können; klassische PDFs gelten nicht mehr als elektronische Rechnung im Sinne der Norm EN 16931.
Für das Ausstellen gelten Übergangsfristen bis 2026 bzw. 2027 (u. a. für Unternehmen mit Vorjahresumsatz ≤ 800.000 €). ZUGFeRD (ab 2.0.1) und XRechnung sind zulässige Formate. E-Rechnung an Privatpersonen (B2C) bleibt vorerst freiwillig. Hier erhalten IT-Leiter, IT-Management, Rechnungswesen, Einkauf und Vertrieb einen kompakten Überblick mit Beispielen, Checklisten und internen Links.
Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet die E-Rechnungspflicht ab 2025 konkret?
Seit 01.01.2025 unterscheidet das UStG nur noch zwischen E-Rechnungen (strukturiert, maschinenlesbar) und sonstigen Rechnungen (Papier, unstrukturiertes PDF). Eine E-Rechnung muss die elektronische Verarbeitung ermöglichen; einfache PDFs reichen nicht mehr. Empfangen können müssen alle Unternehmen – ein E-Mail-Postfach genügt als Start.
- Gilt für: Umsätze zwischen inländischen Unternehmern (B2B).
- Gilt nicht für: Verbraucher (B2C) und viele steuerfreie Umsätze (§ 4 Nr. 8-29 USTG).
- Kleinbetragsrechnungen: bis 250 € weiterhin als sonstige Rechnung möglich.
E-Rechnung-Lösung von munich enterprise software – kompatibel mit XRechnung & ZUGFeRD.
Wer ist betroffen – und wer ist ausgenommen?
Betroffen sind alle Unternehmer , inklusive Freiberufler. Kleinunternehmer sind von der Ausstellungspflicht ausgenommen, müssen aber E-Rechnungen empfangen können. B2C bleibt ohne Pflicht; E-Rechnungen an Privatpersonen sind freiwillig. Beispiele:
- Kleinunternehmer (Beispiel Agentur): darf weiterhin PDFs versenden, muss E-Rechnungen empfangen/archivieren können.
- Handwerksbetrieb B2B: Empfangen ab 2025 Pflicht; Ausstellung kann bis Ende 2026 (ggf. 2027) noch als „sonstige Rechnung“ erfolgen – mit Zustimmung des Empfängers bei elektronischen PDFs.
- Rechnung an Privatkunde: weiterhin Papier oder PDF erlaubt; E-Rechnung freiwillig.
Jetzt unser E-Book lesen zum Thema E-Rechungspflicht 2025:
Formate & Standards: XRechnung, ZUGFeRD & EN 16931
Zulässig sind Formate nach EN 16931, insbesondere XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0.1 (ohne MINIMUM/BASIC-WL). Bestehende EDI-Verfahren können weitergenutzt werden, sofern die Daten vollständig extrahierbar sind. Kurzer Überblick:
- XRechnung: XML-basiert; Standard im öffentlichen Bereich (B2G), im B2B weit verbreitet.
- ZUGFeRD 2.x: Hybrid (PDF + XML). Praktisch, wenn Beleg auch „menschlich“ lesbar sein soll.
- EDI/EDIFACT: bei Vereinbarung weiterhin möglich (Voll-Extraktion der Pflichtangaben).
Passende Produkte & Integrationen von munich enterprise software:
- SAP E-Rechnung – Rechnungsversand
- MailCenter – zentrale Rechnungs-Kommunikation
- Outlook-Integration – Belege direkt aus Outlook verarbeiten
- Monitoring – Transparenz im Rechnungsfluss
Zeitplan & Übergangsfristen (2025–2027)
Die Pflicht kommt stufenweise:
- Ab 01.01.2025: Alle Unternehmen müssen E-Rechnungen empfangen können.
- 2025–2026: Für die Ausstellung dürfen Unternehmen wahlweise noch eine „sonstige Rechnung“ (Papier, PDF mit Zustimmung) verwenden.
- Bis 31.12.2027: Verlängerte Übergangsfrist für Aussteller mit Vorjahresumsatz ≤ 800.000 €; auch nicht-konforme EDI-Verfahren dürfen bis dahin weiterlaufen. Erst danach ist das Ausstellen als E-Rechnung für alle verpflichtend.
Hinweis: PDF ist keine E-Rechnung. Unternehmen sollten rechtzeitig auf XRechnung/ZUGFeRD umstellen und Prozesse (ERP, Workflow, Archiv) anpassen. IHK-Übersichten bestätigen die neuen Definitionen.
Praxisleitfaden: In 6 Schritten zur E-Rechnung
- Ist-Analyse: Welche Systeme erstellen/empfangen Rechnungen (ERP, DMS, E-Mail)?
- Formate festlegen: XRechnung, ZUGFeRD oder EDI – je nach Kunden/Lieferanten.
- Technik anbinden: E-Rechnungsmodul aktivieren, Schnittstellen testen, Leitweg-ID nur für B2G.
- Prozesse definieren: Eingangsprüfung, Freigabe, Buchung, Archivierung.
- Partner informieren: Austauschweg (E-Mail, Portal, API) vereinbaren.
- Rollout & Schulung: Fachbereiche (Einkauf, Vertrieb, FiBu) einbinden.
Beispiel: Ein mittelständischer Hersteller vereinbart mit Lieferanten die XRechnung per E-Mail. Eingehende XML werden im Freigabeverfahren geprüft, per Outlook-Integration zugeordnet, per Rechnungsversand versendet und im Monitoring nachverfolgt – klar, revisionssicher, effizient.
FAQ – Fragen zur E-Rechnungspflicht 2025
Eine strukturiert aufgebaute elektronische Rechnung nach EN 16931, z. B. XRechnung oder ZUGFeRD 2.x. PDFs ohne strukturierten XML-Teil sind keine E-Rechnungen.
Wer muss ab 2025 E-Rechnungen empfangen?
Alle inländischen Unternehmer – unabhängig von Größe oder Branche.
Ab wann muss ich E-Rechnungen ausstellen?
2025/2026 bestehen Übergangsregeln; vollständig verpflichtend wird das Ausstellen nach Ablauf der Fristen (spätestens Ende 2027 für kleine Aussteller). Planen Sie die Umstellung jetzt.
Gibt es eine ZUGFeRD-Pflicht?
Nein. Zulässig sind Formate nach EN 16931; verbreitet sind XRechnung und ZUGFeRD (ab 2.0.1).
Gilt die E-Rechnungspflicht für Kleinunternehmer?
Kleinunternehmer sind von der Ausstellungspflicht ausgenommen, müssen aber E-Rechnungen empfangen können.
Gilt die Pflicht auch im B2C (Privatkunden)?
Nein. Für Privatpersonen besteht keine Pflicht; E-Rechnungen sind dort optional.